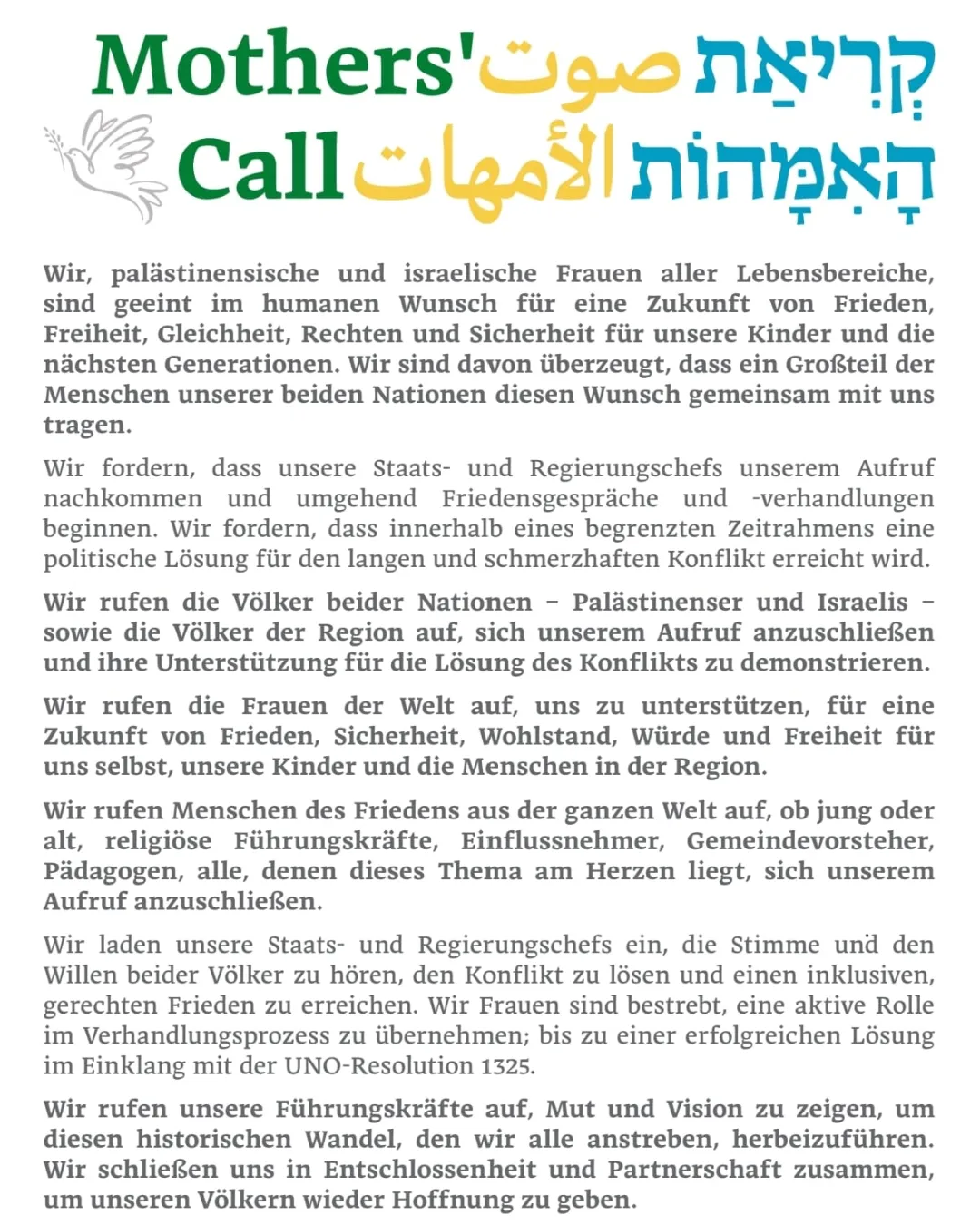Uncategorised
Eine Offene Frage (nicht nur) an den Vorstand des Zentralrats und an Mitglieder jüdischer Gemeinden
von Edith Lutz
Nein, keine übliche Israelhetze, wie jüdische Menschen vielleicht spontan aufgrund des Titelbeginns denken mögen (wohl nicht so die Mitglieder der „Jüdische Stimme“, die seit 2003 die Politik Israels kritisiert – und dafür kritisiert wird; und vermutlich auch nicht eine Mehrheit aus dem nichtorganisierten Judentum, deren Stimmen weniger zu hören sind).
Meine Position ist eine in der Mitte einer Brücke stehende, von der aus ich gleichermaßen auf die israelische und die palästinensische Seite blicke, jeder Seite zuhöre und mich im Mitempfinden unterschiedlicher Leiden und Empfindungen übe. Diese Position ist eine gewachsene. Ihr Beginn liegt in der Vergangenheit auf israelischer Seite.
Als ich in jungen Jahren im Rahmen einer Begegnungsreise zwischen Deutschen und Israelis in einem Kibbuz arbeitete – im Kibbuz Mefalsim nahe der Grenze zum Gazastreifen – hörte ich in einer Gesprächsrunde von den israelischen Gastgebern zwei Sätze, die bis heute in mir nachhallen.
Der eine stellt eine Warnung dar: „Geht nicht nach Gaza, dort ist es zu gefährlich.“ Natürlich befolgten wir den Rat. Vierzig Jahre später war ich nicht mehr so folgsam. Ich hatte in der Zwischenzeit Palästinenser persönlich kennengelernt, meine Angst war gewichen, Vorurteile weitestgehend abgebaut. Ein kleiner christlich-jüdisch-muslimischer Freundeskreis beabsichtigte, in Gaza einen Kindergarten für stark traumatisierte Kinder zu errichten. Ich wollte erkunden, ob und wie dies möglich wäre. Nur, es war 2007 – der Gazastreifen abgeriegelt. Ich versuchte die Einreise ein Jahr später auf dem ersten Schiff der „Freegaza“-Bewegung, die dank der Olmert-Regierung störungsfrei gelang. Vom Schulkind bis zum Regierungspräsidenten begegneten mir Menschen, die mich – mit dem Davidstern – willkommen hießen und mir ein anderes Bild von Gaza vermittelten als gewohnte Medien. Viele meiner Gesprächspartner sind durch israelische Bombenangriffe getötet worden oder leben in größter Verzweiflung.
Verzweiflung ist auch bei Menschen auf der anderen Seite der Brücke, jüdischen Israelis oder dem mit Israel verbundenen Judentum anzutreffen. Wer nur den arroganten Soldaten sieht, den Rächer, der Grausamkeit mit noch größerer Grausamkeit rächt, verkennt oft die tiefsitzende Angst, die in ihm steckt. Es ist nicht nur die Erblast jahrhundertelanger Verfolgungen; die Angst vor Vernichtung in unseren Tagen oder die Angst, den „Rettungsanker Israel“ zu verlieren, ist keineswegs realitätsfern. Und sie wächst in dem Maße, wie sie nicht erkannt wird. Dass grausames Verhalten auch einer falsch verstandenen Ideologie entspringen kann, sei hier unberücksichtigt (s. hierzu „Mit Macbeth in den Untergang “
Verzweiflung und Angst kennen auch Israelis, die sich nicht an der Zerstörung in Gaza oder in der Westbank beteiligen oder sie billigen und sich stattdessen zusammen mit Palästinensern einsetzen, um ihr entgegenzuwirken. Häufig hat ein besonderer Schicksalsschlag wie der Verlust eines lieben Angehörigen durch Feindeshand dazu geführt, Angst zu überwinden oder Gleichgültigkeit abzulegen und sich der Verständigung beider Völker zu widmen. Sie mögen verzweifelt ob des zunehmenden Faschismus ihrer Regierung sein, des Alleinseins in einem Strom von mehr oder weniger (zunehmend weniger) Regierungskonformen oder fehlender Unterstützung aus dem Ausland und hier besonders der jüdischen „Diaspora“.
Jüdinnen und Juden außerhalb Israels haben Einsichten in Bilder der Zerstörung, die Israelis von den Medien vorenthalten werden, doch ein Aufschrei ist nicht zu hören. Vielleicht ist ein bekanntes psychologisches Phänomen dafür verantwortlich, dass er unterbleibt und Kritik nur vorsichtig und oft nur unter seinesgleichen geäußert wird. Die menschliche Psyche trägt Sorge vor zu viel Beachtung „der anderen Seite“ bei Missachtung des eigenen Leids, der Angst in all ihren Facetten. Und die Angst vor Antisemitismus steigt mit seinem Ansteigen. Folglich ertönt der Aufschrei „Antisemitismus!“
Der innere Aufschrei scheint die Wahrnehmung des gefährlichen Ausmaßes einer rechtsgerichteten, zunehmend faschistischer werdenden israelischen Regierung zu übertönen - eine angemessene Reaktion auf eine menschenverachtende Besatzungspolitik und deren Folgen fehlt. Hier einige Äußerungen von israelischen Verantwortlichen, zu denen ein Aufschrei von jüdischer Seite zu erwarten gewesen wäre:
- Der ehemalige Verteidigungsminister Yoav Galant: „Wir bekämpfen menschliche Tiere.“- Knessetsprecher Nissim Vaturi: „Israels Ziel sollte sein, den Gazastreifen von der Erde zu tilgen. Wir müssen da hineingehen und töten, töten, töten.“- Finanzminister Bezalel Smotrich: „Gaza ist zerstört und verwüstet und so wird es auch bleiben.“
In sozialen Medien finden sich Posts von israelischen Soldaten in Gaza, die zur Tötung von Arabern, dem Verbrennen ihrer Mütter und zur Niedermachung Gazas aufrufen. Schon seit Jahrzehnten gibt es Graffiti an öffentlichen Mauern in Israel, „Kill the Arabs“ oder „Arabs to the gas chambers“ – Wir haben uns vielleicht daran gestört, aber nicht geschrien.
Ob es diese Aufrufe schon bei meinem ersten Aufenthalt in Israel gab, entzieht sich meiner Erinnerung. Aber noch einmal zurück in den Kibbuz Mefalsim (es ist übrigens der gleiche Kibbuz, der im Januar 2008 von Gush Schalom gesammelte Spenden lagerte, die für einen Hilfskonvoi nach Gaza bestimmt waren). Die zweite Äußerung aus der Gesprächsrunde mit den israelischen Bewohnern lautete: „Wir haben sie doch weggehen sehen!“ Gemeint waren die palästinensischen Flüchtlinge während des ersten israelisch-arabischen Kriegs, von denen einer der deutschen Jugendlichen meinte, sie seien nicht freiwillig gegangen. Wer hatte Recht? Damals, ganz klar, die Israelis. Im neuen Jahrtausend, nachdem die Archive längst geöffnet sind, kann sich jeder über Vertreibung von Palästinensern und Zerstörung ihrer Dörfer informieren. Die „freiwillig“ Geflüchteten folgten dem Diktat ihrer Angst angesichts erlebter oder berichteter Grausamkeiten.
„Wo bleibt die Erwähnung arabischer Grausamkeiten“, werden Leser/Hörer sich vielleicht fragen. Doch geht es hier nicht um die eine oder andere Seite und schon gar nicht um Verurteilung der einen oder anderen Seite. Angesprochen sind Vertreter der jüdischen Religion, meine Sorge gilt ihr. Wenn sie an Glaubwürdigkeit verliert, steigt auch der Antisemitismus. Und sie verliert an Glaubwürdigkeit, wenn ihre Vertreter fordern, Israel bedingungslos die Treue zu halten. Die Frage „welchem Israel?“ ruft nach einer klaren und deutlich zu vernehmenden Antwort. Die derzeitige israelische Regierungspolitik kann nicht von jenen unterstützt werden, die jüdischer Ethik treu bleiben. Unterstützen wir all jene in Israel, die sich für ein friedliches Zusammenleben von jüdischen Israelis und Palästinensern einsetzen; NGOs wie den Parents Circle, Combatants for Peace, Standing Together , viele andere Organisationen und Einzelpersonen.
„Suche Frieden und strebe ihm nach“. Wer den Psalm befolgt, wird sich fragen, ob er der israelischen Politik der Gewalt (selbst wenn sie als Verteidigung verstanden wird) etwas entgegensetzen will; einen öffentlichen Aufruf, eine Stellungnahme zum Töten von Zivilisten oder zur Einfuhrverweigerung dringend benötigter Mittel beispielsweise; ein Aufruf „Nicht in meinem Namen!“. Und er wird sich dem Dialog nicht verweigern – einem Dialog der Gewaltfreien Kommunikation/GfK beispielsweise. Sie sieht vor, die eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu äußern und denjenigen der Gesprächspartner zuzuhören, mit Respekt vor dem Anderen als einem göttlichen Geschöpf mir gleich. Wer sich darin übt, bewahrt die „Treue“ zur Religion, von der Martin Buber spricht („Der Jude und sein Judentum“, in: Martin Buber und die Vision einer jüdischen Erneuerung. Er mag gegen den Strom schwimmen, wie seinerzeit die Propheten, oft einer Minderheit zugehörig. Es waren zumeist Minderheiten, die den unauslöschlichen Kern jüdischer Religion, gefüllt mit Liebe und dem steten Ruf nach Verantwortung, in eine neue Phase des Judentums trugen.

Die israelisch-palästinensichen Friedensstreiter - Combatants for Peace/CfP - sind in Deutschland nicht unbekannt. 2014 nahmen sie in Bonn von der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden/ EAK einen Friedenspreis entgegen. Combatants for Peace werden in Deutschland von "Forum ZFD", "Die Schwelle", "New Israel Fund", "Rosa-Lusemburg-Stiftung" und anderen Organisationen unterstützt. In den Veröffentlichungen des Deutsch-Israelischen Arbeitskreises /DIAK sind die "Combatants" ein wiederkehrendes Thema.
Eigendarstellung "Wer wir sind" nach der Website von CfP:
Wir, Combatants for Peace, sind eine Graswurzelbewegung von Israelis und Palästinensern, die gemeinsam für eine Beendigung der Besatzung, für Frieden, Gleichheit und Freiheit in ihrem Heimatland arbeiten. Von Beginn an sind wir der Gewaltfreiheit verpflichtet. Unsere Mittel sind ziviler Widerstand, Erziehung und kreative Aktivität, um Systeme der Unterdrückung zu transformieren und eine freie friedliche Zukunft von Grund auf vorzubereiten.
Seit dem Gründungsjahr 2006 sind wir die weltweit einzige Bewegung, die von früheren Kämpfern auf beiden Seiten des Konflikts gegründet wurde. In der Folge wurden wir 2017 und 2018 für den Nobelpreis nominiert.
Unsere Vision: Wir glauben an eine Zukunft, in der alle Menschen in Frieden mit Würde, Gerechtigkeit und Freiheit leben können.
Unsere Mission: Combatants for Peace (CfP) ist eine israelisch-palästinensische Gemeinschaft, die sich für ein Ende der Besetzung, Diskriminierung und Unterdrückung aller Menschen, die in unserem Land leben, einsetzt. Geführt von den Werten gewaltfreien Widerstandes zeigen wir der Welt: Es gibt einen anderen Weg.
Combatants for Peace wird durch einen Führungskreis geleitet (ähnlich einem Vorstand oder "Board of Directors"), der sich für Management, Direktion und Vision der Bewegung verantwortlich zeigt. Die israelische Belegschaft arbeitet von ihrem Büro in Tel Aviv aus, die palästinensische aus Bejt Jala. Zusammen arbeiten sie an der Infrastruktur und kümmern sich um die finanzielle Unterstützung für die Bewegung. Es gibt eine Führungsriege für Aktivitäten, die lokale Kampagnen und Aktivitäten steuert und koordiniert.
Die Schüler helfen bei der Organisation des öffentlichen Auftritts der Tanzgruppe in ihrer Schule, sie verteilen Einladungen. Die eingeladene Presse (KStA) zitiert die einführenden Worte Xokonoschtetls: "Wir fordern nur einen Teil unserer Kultur zurück, die Krone muss nach Hause, wo sie hingehört." Über Zivilisation sagt er: " Je höher die Menschen zivilisiert sind, um so mehr trennen sie sich von unserer Mutter Erde. Doch soviel wissen wir: Wer sich von der Erde trennt, wird einsam und krank".
Am darauffolgenden Tag tanzt die Gruppe in der großen Turnhalle für alle Schüler. Xokonoschtetl erklärt ihnen die Tänze: "Die Zahl der Schritte oder der Trommelschläge hat eine tiefe Bedeutung. Unser Volk setzt den Durchmesser der Sonne, die Entfernung zum Mond oder andere komplizierte astronomische Daten in Tanz um. Eigentlich sind dies keine Tänze im eigentlichen Sinne, sondern der Ausdruck unseres Dankes an die Natur."
Ich bin in einer Familie aus der Gemeinde zu Gast, einer Mischlingsfamilie typisch für Sarajevo: jüdisch-muslimisch-katholisch. Die meisten Gemeindemitglieder leben in einer Mischehe. Viele Häuser in Sarajevo sind durch Granateneinschlag beschädigt, viele Fenster haben statt der Scheiben Kunststoffplanen. Die Fenster in der Wohnung meiner Gastfamilie sind heil geblieben. Aber etwas erinnert auch hier an den Krieg und wird mich fortan jeden Winter wieder erinnern lassen: der kleine alte Ofen, der jetzt auf dem Balkon steht. Milena erzählt in Zeichensprache, womit der Ofen letzten Winter gefüttert wurde: sie zeigt auf Bücher und ein paar alte Schuhe - Holz gibt es in der belagerten Stadt nicht mehr.
Während meiner Anwesenheit veranstaltete die Jüdische Gemeinde zusammen mit den Vertretern weiterer Religionsgemeinschaften in Sarajevo einen Friedensgottesdienst. Jede Gemeinschaft hatte sprachliche oder musikalische Beiträge vorbereitet. Der buddhistische Beitrag bestand aus einem einzigen Klang, der noch lange nachhallte.
Es war unnötig gewesen, einen gefüllten Spendenkoffer in der Jüdischen Gemeinde zu lassen, er wurde andernorts dringender gebraucht. Mit dem zweiten Koffer machte ich mich auf in den serbischen Teil Bosniens. Eine Verkehrsverbindung gab es noch nicht. Privatfahrer boten sich als Taxifahrer an.

Auf dem Weg Bilder der Zerstörung, Gefühle von Angst, Hass und Enttäuschung. Viele von der Nato zerstörte Brücken über die Drina. Ich biete dem Fahrer neben guter Bezahlung einen Teil meiner Spenden an, damit er mich sicher nach Foҫa und zurück bringt. Für ein Krankenhaus habe ich Bettwäsche, Medikamente und weitere Geschenke im Gepäck. Die Kommunikation mit meinen Gesprächspartnern, einem Arzt und einer Ärztin, erweist sich als schwierig, obwohl wir Englisch sprechen. Die Barrieren scheinen in Angst und Vorurteil zu liegen - westliche Medien hatten die Serben einseitig als Gräueltäter dargestellt. Es sieht zunächst so aus, als wäre mein Besuch, die Geschenke, unerwünscht. Stolz? Es wird nur wenig gesprochen, der Koffer kaum beachtet. „Soll ich die Sachen wieder mitnehmen?“ Meine Frage ist eigentlich eine andere: „Wie erreichen wir uns?“ Jetzt bricht die Mauer, bricht es aus, zunächst die Tränen, dann die Worte. „Wir haben nichts, nichts“. Dann wird ausgepackt. Und „This is like Christmas“.